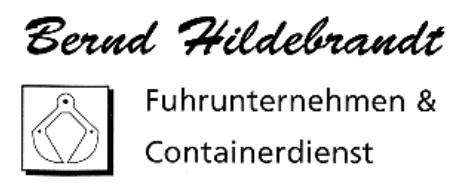Wenn es im Sommer heiß wird, ist ein Planschbecken im Garten oder auf dem Balkon für viele Familien ein willkommener Abkühlungsort. Doch damit das kühle Nass keine Risiken birgt, lohnt sich ein genauer Blick auf Modell und Material. Wichtig ist auch die angedachte Nutzung.
Tüv-Produktexperte Morten Rosenfeld erklärt, worauf Eltern beim Kauf und beim täglichen Gebrauch achten sollten:
● Altersempfehlung beherzigen: Baby-Planschbecken sind für Kinder gedacht, die schon sitzen können. Hier ist eine Wasserhöhe von zehn Zentimetern vollkommen ausreichend, um den Kleinsten eine sichere Abkühlung zu ermöglichen. Größere Modelle eignen sich für Kinder ab etwa vier Jahren.
● Sicheres Material wählen: Achten Sie auf schadstofffreie Kunststoffe - vor allem sollte das Becken frei von Phthalat-Weichmachern sein, da sich diese im Wasser lösen können, so Rosenfeld.
● Stabilität prüfen: Aufblasbare Becken mit mehreren Luftkammern sind robuster, da sie nicht sofort in sich zusammenfallen, wenn eine Kammer Luft verliert. Alternativ gibt es faltbare Modelle mit Stangenkonstruktion. Standort mit Bedacht wählen: Das Becken sollte auf einer ebenen Rasenfläche stehen. Auf dem Balkon ist Vorsicht geboten: „Ein Baby-Planschbecken mit einer Kapazität von 50 stellt Litern stellt noch kein Sicherheitsrisiko dar. Ein großes, gefülltes Planschbecken hingegen kann mehrere hundert Kilogramm wiegen und schnell die Maximalbelastung des Balkons überschreiten“, warnt Rosenfeld.
● Hygiene einhalten: Bei Babybecken sollte das Wasser täglich gewechselt werden. Bei Becken, in denen ältere Kinder planschen, reicht ein Wechsel alle drei Tage. Auf chemische Zusätze wie Chlor sollte man verzichten - bei den kleinen Wassermengen ist das Risiko einer Fehldosierung zu hoch.
Wichtig: Kleine Kinder nie unbeaufsichtigt im oder am Wasser spielen lassen - selbst dann nicht, wenn das Becken nur wenige Zentimeter gefüllt ist. Fällt ein Kleinkind mit dem Gesicht voran ins Wasser, kann es sogar bei Tiefen von zehn Zentimetern ertrinken.
dpa
Bei Flecken schnell reagieren
Geht am Esstisch mit Holzoberfläche etwas daneben, sollte man schnell reagieren. Denn je länger ein frischer Fleck auf das Material einwirken kann, desto schwieriger bekommt man ihn später wieder weg. Darauf weist die Initiative Furnier + Natur (IFN) hin. Doch wie reinigt man furnierte Oberflächen, etwa Möbel, Türen oder Wandverkleidungen, am besten? Die Initiative gibt Tipps - die sich je nach der Art des Furniers unterscheiden.
Offenporige Furniere versus versiegelte Oberflächen
Offenporige Oberflächen sind naturbelassen oder mit einer offenporigen Holzlasur behandelt. Solche Furniere säubert man am besten vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch - und zwar trocken.
Furniere, die etwa mit Lack, Öl oder Wachs versiegelt sind, sollte man hingegen mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Danach die Oberfläche mit einem anderen, weichen Tuch trocken reiben.
Kein Putzmittel und keine Mikrofasertücher
Für beide Arten gilt laut IFN: Reinigungs-, Putzmittel oder gar Scheuermilch sollte man bei Holz nie verwenden. Auch auf Mikrofasertücher besser verzichten, da diese Kratzer hinterlassen können. Tipp: Pflegen lassen sich Furniere, indem man eine Milchpolitur sparsam und ohne großen Druck verteilt - dafür eignet sich etwa ein frisches Staubtuch.
dpa